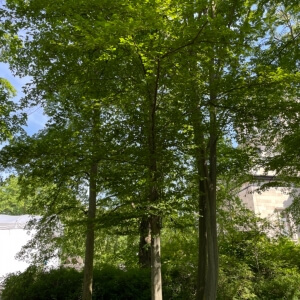https://www.naturadb.de/pflanzen/picea-abies/?thema=15

| Licht: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | durchlässig bis humos |
| Wasser: | frisch |
| Nährstoffe: | normaler Boden |
| PH-Wert: | sauer bis kalkhaltig |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | aufrecht, kegelförmig |
| Höhe: | 30 - 50 m |
| Breite: | 6 - 8 m |
| Zuwachs: | 40 - 55 cm/Jahr |
| frostverträglich: | bis -45,5 °C (bis Klimazone 2) |
| Wurzelsystem: | Flachwurzler |
| Blütenfarbe: | rot |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | zapfenförmig |
| Blattfarbe: | grün |
| Blattphase: | wintergrün |
| Blattform: | nadelförmig |
| Schmetterlinge: | 1 |
| Raupen: | 25 (davon 16 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 9 |
| Käfer: | 26 |
floraweb.de.
| Höhenlage: |
planar (<100m1 / <300m)2 bis subalpin (1000m-1100m1 / 1500m-2500m)2 1 Mittelgebirge / 2 Alpen |
| ist essbar |
junge Triebe Verwendung: Gewürz, Tee, Salat, Spirituos. |
| Pflanzen je ㎡: | 1 |

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!
Gewöhnliche Fichte, Gemeine Fichte oder Rottanne (Picea abies) ist ein in unseren Wäldern häufiger Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae). Sie hat ein weites Verbreitungsgebiet von Mitteleuropa bis nach Ostasien, wobei ihre Vorkommen in Alpen und Balkan die südwestliche Grenze darstellen. Die Fichte wächst bei uns wild bevorzugt in winterkalten und luftfeuchten Lagen der montanen und subalpinen Höhenstufen über 800 Metern Höhe, weiter nördlich und im Osten auch im Flachland von Mischwäldern und Bergnadelwäldern. Noch häufiger findet sie sich als Nutzbaum auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen.
Picea abies ist ein 30-50, selten über 60 Meter hoher Baum mit geradem Stamm und einer gleichmäßigen spitz kegelförmigen, 6-8 Meter breiten Krone. Der Stammdurchmesser liegt meist bei 1-1,5 Metern und erreicht selten über zwei Meter. Die dicke rotbraune (daher der irreführende Name Rottanne) Schuppenborke löst sich in dünnen Platten ab. Bei freiem Stand sind die Bäume häufig bis nahe zum Boden hin beastet, im dichten Wald fehlen die unteren Äste. Im unteren Teil zeigen die quirlig in Etagen angeordneten Äste nach unten, weiter oben stehen sie aufrecht, und die Zweige sind meist hängend. Es gibt nur Langtriebe, Kurztriebe fehlen völlig. Junge Zweige sind spärlich behaart oder kahl, gerieft und rotbraun, die nur wenig harzigen Winterknospen kegelförmig oder eiförmig und gespitzt.
Die glänzend dunkelgrünen, festen und stechenden Nadelblätter der Gewöhnlichen Fichte sind 1-3 Zentimeter lang und nur einen Millimeter breit, im Querschnitt rautenförmig bis quadratisch vierkantig. Sie stehen schräg nach vorne gerichtet in dichten Spiralen an den Langtrieben, auf der Unterseite der Zweige gescheitelt und bleiben meist 5-7 Jahre erhalten; blattlose Zweige sind durch die verbleibenden gehöckerten Nadelkissen rau.
Rottannen sind einhäusig getrenntgeschlechtlich; die Blüten finden sich nur im oberen Kronenbereich an den Zweigen des Vorjahres. Dort hängen die 1-2 Zentimeter langen männlichen Blütenstände einzeln in den Blattachseln; zunächst purpurrot gefärbt werden sie bei der Blüte durch den hervortretenden Pollen hellgelb. Die endständigen weiblichen Blütenstände stehen dagegen aufrecht; sie werden 5-6 Zentimeter lang und sind hellrot oder gelbgrün gefärbt.
Die daraus gebildeten braunen und verholzten, harzreichen Zapfen hängen an den Zweigen herab; sie sind zylindrisch, 10-15 Zentimeter lang und geöffnet 3-4 Zentimeter breit. Im Inneren der Samenschuppen befinden sich die 4-5 Millimeter langen, mit einem löffelartig aufsitzenden Flügel versehenen braunen Samen. Die Blütezeit reicht vom April und Mai bis in den Juni hinein, und die Samenreife erfolgt von September bis November des gleichen Jahres. Im Gegensatz zu den zerfallenden Tannenzapfen fallen die Fichtenzapfen im Ganzen herunter und finden sich daher in Mengen am Fuß der Bäume: Anders als im Volksmund sind die Tannenzapfen, die Kinder gerne sammeln und die man auch in der Kranzbinderei einsetzt, in Wirklichkeit Fichtenzapfen.

Fichten bevorzugen einen frischen bis nassen, schwach sauren bis alkalischen, modrig-torfigen oder humosen lockeren Lehm- und Tonboden, der auch Steine und Sand enthalten darf. Die Flachwurzler fühlen sich in winterkalten und luftfeuchten Lagen am wohlsten. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Als einheimischer Nadelbaum ist sie natürlich vollkommen winterhart. Empfindlich reagiert sie auf länger anhaltende sommerliche Hitze und Trockenheit.
Ein Schnitt ist bei der Gewöhnlichen Fichte nur erforderlich, wenn Du sie als Hecke halten möchtest. Ansonsten wächst sie ohne Dein Zutun zu einem dekorativen Baum heran. Tote abgestorbene Äste kannst Du natürlich jederzeit beseitigen.
Üblicherweise wirst Du eine junge Fichte kaufen, wenn Du sie in den Garten setzen möchtest. In Baumschule und Gartenmarkt gehört sie zum Standardsortiment und ist überall erhältlich. Sorten lassen sich nur durch Veredlung, Zwergformen häufig auch durch Stecklinge vom reifen Holz vermehren.
Natürlich kannst Du Dich auch gerne im Frühjahr an einer Aussaat versuchen; die Lichtkeimer bleiben 3-5 Jahre keimfähig und gehen zu 80-90 Prozent auf. Die Keimlinge haben 6-10, meistens acht oder neun Keimblätter. Mannbar werden die Bäume als Solitäre mit 20-25 Jahren, im Wald erst mit 50-60 Jahren. Ihre Endhöhe von 30-50 Metern erreichen sie nach etwa hundert Jahren.
Die Gewöhnliche Fichte ist nicht nur mit der wichtigste Forstbaum in unseren Wäldern, man pflanzt den genügsamen und anpassungsfähigen Baum häufig auch in Parks und Grünanlagen. Daheim wird man sie lieber nur in großen Gärten zum Einsatz bringen, denn im Alter werden die Bäume mit bis zu 50 Metern doch recht mächtig. Eine Alternative für mittlere und kleine Gärten sind die zahlreichen Zuchtsorten, von denen viele deutlich kleiner bleiben als die Wildart. Bisweilen nutzt man sie auch als Hecke.
Achtung: Für Gärten an vielbefahrenen Straßen ist sie nur bedingt geeignet, die Fichte ist nur wenig rauchhart und kommt mit den Abgasen nicht gut klar. Apropos Waldsterben. Auch zur Kübelbepflanzung ist sie nicht eben prädestiniert, hier greift man besser auf die Zwergsorten der Kiefer zurück.
Vor allem Monokulturen der Fichte sind von Schädlingen und Krankheiten bedroht, die hier in der Masse günstige Bedingungen vorfinden. Zu den gefürchtetsten Krankheiten gehören Pilze wie Hallimasch (Armillaria mellea) und Rotfäulepilz (Heterobasidion annosum). Als Schädlinge sind vor allem Borkenkäfer gefürchtet, aber auch die Grüne Fichtengallenlaus (Sacchiphantes viridis) kann erhebliche Schäden hervorrufen.
Auf Magerweiden und Waldlichtungen bewährt sich die Gemeine Fichte als Pioniergehölz, das die freien Flächen schnell für sich vereinnahmt. Dabei wird sie durchaus rabiat: Ihre saure und langsam verrottende Nadelstreu und die nur wenig Licht durchlassenden Kronen hemmen das Wachstum der meisten Pflanzen in der Umgebung, sodass die Baumscheibe meist unbewohnt bleibt und in Fichtenforsten kaum Unterholz und bestenfalls eine spärliche Krautschicht zu finden sind.
Die Bestäubung wie auch die Verbreitung der geflügelten Samen übernimmt der Wind, wobei zahlreiche Tiere, vor allem Vögel und Eichhörnchen beim Freisetzen der Schraubenflieger gerne behilflich sind. Vögel wie Eichelhäher, Schwarzspecht und Waldkauz, aber auch Säugetiere wie Wildschweine, Rehe und Hirsche nutzen die dichten und dunklen Fichtenforste mit ihren reich verzweigten Kronen gerne als Unterschlupf.
Für das Grün der Nadeln als Raupenfutter interessieren sich insgesamt 29 Schmetterlinge – mit Ausnahme des tagaktiven Grünen Zipfelfalters (Callophrys rubi) allesamt Nachtfalter. Mit die wichtigsten davon sind Kiefernspinner (Dendrolimus pini) und Kiefernspanner (Bupalus piniaria), der Kiefernschwärmer (Sphinx pinastri) sowie Kieferneule (Panolis flammea), Nonne (Lymantria monacha) und Klosterfrau (Panthea coenobita).
Wenngleich die Fichtenblüten keinen Nektar bieten finden sich Honigbienen, die ursprünglich Waldbewohner waren, gerne an den Bäumen ein. Dort sammeln sie nicht nur das Harz, um daraus ihr universelles Desinfektionsmittel Propolis herzustellen, sondern auch die klebrig-süßen Ausscheidungen von Läusen, den Honigtau. Daraus machen die fleißigen Bienen Honig– je nach Beständen ergibt das einen gemischten Waldhonig, in dem auch der Honigtau von Eichen und Kastanien verarbeitet ist, oder bei hinreichend großen Fichtenbeständen einen reinen Sortenhonig: Fichtenhonig ist hell- bis dunkelbraun, flüssig und hat einen malzigen, leicht herben Geschmack.
Unter der Erde tut sich ebenfalls einiges – die Fichte bildet mit zahlreichen Pilzen eine Mycorrhiza aus und tauscht Zucker aus der Photosynthese gegen Nährstoffe aus dem Boden. Einige davon bilden auffällige Fruchtkörper, darunter begehrte Speisepilze wie Steinpilz (Boletus edulis), Maronenröhrling (Imleria badia) und Ziegenlippe (Xerocomus subtomentosus), aber auch gefürchete Giftpilze wie Fliegenpilz (Amanita muscaria) und Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina).
Das große natürliche Areal der Fichte wird von zwei morphologisch leicht unterscheidbaren Unterarten bevölkert. Bei uns bis ins Baltikum und nach Nordrussland hinein gedeiht die europäische Picea abies ssp. abies mit kahlen Zweigen, 1-3 Zentimeter langen Nadeln und 10-15 Zentimeter großen Zapfen. Dagegen herrscht in Skandinavien und jenseits des Ural die nordeuropäisch-asiatische Form Picea abies ssp. obovata vor, die sich durch behaarte Zweige, 1-2 Zentimeter lange Nadelblätter und nur 4-8 Zentimeter lange Zapfen auszeichnet.
Die Gewöhnliche Fichte ist sehr anpassungsfähig und kommt mit vielen Lebensräumen zurecht. Als extrem gelten die Vorkommen in Nordsibirien, wo sie im Winter bei weniger als -30 °C und im „Sommer“ bei durchschnittlich etwas über +10 °C wächst. Nach Mitteleuropa vorgedrungen ist sie erst nach der letzten Eiszeit vor rund 6000 Jahren. Der forstwirtschaftliche Anbau im großen Stil begann im 18. Jahrhundert; Fichten waren schon damals begehrt, weil sie schnell wachsen und ein gut zu verarbeitendes Holz liefern.
Der Anteil der Fichten an den deutschen Wäldern liegt etwas über 40 Prozent; die früher üblichen pflegeleichten, aber anfälligen Monokulturen sind durch sauren Regen und Waldsterben in Verruf geraten, da sie besonders empfindlich reagieren. Daher bemüht man sich inzwischen um eine Wiederaufforstung mit Mischwäldern. Für den Artenreichtum ist das begrüßenswert, denn in reinen Fichtenwäldern versauern die Böden durch die langsam verrottenden Nadelblätter, sodass andere Pflanzen hier kaum eine Chance haben.
Fichtenholz ist das in Deutschland am häufigsten verwendete Nadelholz. Die Bäume liefern um die 20 Meter lange und 0,4-1,2 Meter dicke Stämme, die über weite Strecken nicht durch Äste unterbrochen sind. Das harzreiche Holz ist weiß bis gelblichweiß, leicht und weich und zeigt nur einen mäßigen Schwund beim Trocknen. Allerdings ist es wenig beständig und verwittert schnell oder wird von Insekten und Pilzen heimgesucht. Verwendung findet es als Bauholz, in der Schreinerei sowie bei der Herstellung von Zellstoff und Papier. 2017 wurde die Gemeine Fichte zum Baum des Jahres gekürt.
Industriell ist auch die gerbstoffreiche Rinde interessant und das Harz, aus dem sich wohlriechendes Vanillin gewinnen lässt. Jungbäume waren bis vor wenigen Jahren der Standard für den festlichen Weihnachtsbaum, bis die im Haus sich schnell ihrer Nadeln entledigende Fichte von beständigeren Nadelbäumen wie Blau-Tanne und Nordmann-Tanne abgelöst wurde.


| Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche FichtePicea abiesWildform | aufrecht, kegelförmig 30 - 50 m 6 - 8 m |
| ||
| ZapfenfichtePicea abies 'Acrocona'immergrün, frosthart, schnittverträglich | breit kegelförmig 3 - 4 m 2 - 4 m |
| braun September | ab 79,90 € |
| Igel Fichte 'Echiniformis'Picea abies 'Echiniformis'zwergiger Wuchs, kugelig-und kissenförmig, matt gelbgrüne bis graugrüne Nadelfärbung | kugel- und kissenförmig 30 - 40 cm 30 - 40 cm | | braun September | |
| Zapfenfichte 'Formanek'Picea abies 'Formanek'immergrün, frosthart, schnittverträglich | niederliegend, kompakt, gut verzweigt, dichtbuschig 75 - 100 cm 1 - 1,25 m | | ||
| Hänge-FichtePicea abies 'Inversa'außergewöhnliche Wuchsform | aufrecht, säulenförmig, hängenden Zweigen 6 - 8 m 2 - 2,5 m |
| ||
| Nestfichte 'Little Gem'Picea abies 'Little Gem'sehr langsam wachsend, Nadeln sehr dünn, dunkelgrüne Nadelfärbung | breit, kissenförmig, langsam wachsend 30 - 50 cm 50 - 70 cm | | ab 22,20 € | |
| Nestfichte 'Nidiformis'Picea abies 'Nidiformis'winterhart, pflegeleicht und robust | halbkugelig, dicht verzweigt 1 - 1,4 m 1,5 - 2,5 m | | braun September | ab 20,10 € |
| KegelfichtePicea abies 'Ohlendorffii'gut schnittverträglich | breit kugelig, später breit kegelförmig 3 - 5 m 2 - 3,5 m |
| braun September | |
| Nestfichte 'Procumbens'Picea abies 'Procumbens'zwergig, breit und flacher Wuchs, Nadeln dick, frischgrüne Nadelfärbung | kleinwüchsig, kegelförmig, kompakt 50 - 100 cm 4 - 5 m |
| braun September | |
| Blaue Pummelfichte 'Glauca'Picea abies 'Pumila Glauca'blaue-grüne Nadelfärbung | plattkugelig, gedrungen 50 - 100 cm 1 - 2 m | | braun September | |
| Zwergfichte 'Pygmaea'Picea abies 'Pygmaea'zwergig, kugelig bis breit, kegelförmig, dicht verzweigt, frischgrüne Nadelfärbung | kugelig bis kegelförmig 1 - 2 m 1 - 2 m |
| braune Zapfen September | |
| Fichte 'Wills Zwerg'Picea abies 'Wills Zwerg'zwergiger, kegelförmiger Wuchs, frischgrüne Nadelfärbung | aufrecht, kegelförmig, dichtbuschig und kompakt 1,5 - 2 m 1 - 1,5 m |
|
Die meisten Fichten erreichen eine Höhe von 30-50 Metern, in Ausnahmefällen auch bis zu 60 Metern. Sie werden 200-600 Jahre alt, wenn sie nicht als Nutzholz ein vorzeitiges Ende findet; dann werden sie meistens mit 80-120 Jahren geerntet.
Fichten werden meist 30-50 Meter hoch und sind dann um die 100 Jahre alt. Das Höchstalter liegt bei bis zu 600 Jahren, wie man aus den Jahresringen besonders alter Exemplare schließen konnte. Die Stämme werden bis zu 20 Meter lang und 0,4-1,2 Meter dick – und das astfrei. Beste Voraussetzungen für ein gutes Bauholz. Rekordhalter in Sachen Höhe ist eine Fichte im zum Sutjeska-Nationalpark gehörenden Urwald von Peru?ica in Bosnien: Bei der Vermessung im Jahre 1970 war sie stattliche 63 Meter hoch.
Die Wildform der Gemeinen Fichte ist einer unserer größten Nadelbäume und wächst recht flott – ein wesentlicher Faktor für ihre Beliebtheit als Forstbaum. Sie legt pro Jahr 20-30 Zentimeter zu, bis sie eine Höhe von 30-50 Metern und eine Breite von 6-8 Metern erreicht hat. In Gärten findet man wesentlich häufiger deutlich kleiner bleibende Zuchtsorten, die nur langsam wachsen und oft nur einen oder zwei Meter hoch werden.
Die Bezeichnung Fichte leitet sich vom althochdeutschen fiohta und mittelhochdeutschen viehte ab, den damals geläufigen Namen des Baumes. Den botanischen Gattungsnamen haben wir den alten Römern zu verdanken; dabei leitet sich Picea von pix, Pech ab, dem klebrigen Fichtenharz.
Für den Garten sind vor allem die kleinbleibenden Sorten der Gewöhnlichen Fichte interessant, die deutlich kleiner als die mit 50 Metern Endhöhe riesige Wildform bleiben. Einige davon werden gerade mal einen oder zwei Meter hoch, wachsen vergleichsweise langsam und unterscheiden sich zudem in der Farbe ihrer Nadeln:
Gewöhnliche Fichte ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Schmetterlinge und Schmetterlingsraupen