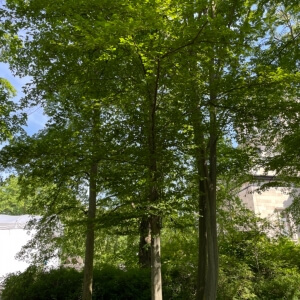https://www.naturadb.de/pflanzen/pinus-mugo/

| Licht: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | durchlässig bis normal |
| Wasser: | feucht bis trocken |
| Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
| PH-Wert: | sauer |
| Kübel/Balkon geeignet: | ja |
| Salzverträglich: | ja |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | buschig, ausladend |
| Höhe: | 50 - 500 cm |
| Breite: | 50 - 600 cm |
| Zuwachs: | 5 - 15 cm/Jahr |
| windverträglich: | ja |
| frostverträglich: | bis -34 °C (bis Klimazone 4) |
| Wurzelsystem: | Flachwurzler |
| Blütenfarbe: | rosa |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | unscheinbar |
| Blattfarbe: | grün |
| Blattphase: | wintergrün |
| Blattform: | nadelförmig |
| Bestandssituation (Rote Liste): | selten |
| Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
| Schmetterlinge: | 1 |
| Raupen: | 10 (davon 5 spezialisiert) |
| Schwebfliegen: | 4 |
| Käfer: | 29 |
floraweb.de.
| Höhenlage: |
montan (500m-600m1 / 800m-1200m)2 bis subalpin (1000m-1100m1 / 1500m-2500m)2 1 Mittelgebirge / 2 Alpen |
| ist essbar |
Nadeln, Zweigspitzen, Äste Verwendung: Öl (innerlich u. äusserlich) |

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!
Bergkiefer, botanisch korrekter Berg-Kiefer, Berg-Föhre, Latsche, Krummholzkiefer oder Echte Legföhre (Pinus mugo) ist ein einheimischer Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae). Man findet sie in den Gebirgsregionen Süd- und Mitteleuropas in zahlreichen nicht miteinander zusammenhängenden Arealen. Am häufigsten ist die Bergkiefer in den Alpen und Pyrenäen, im französischen Zentralmassiv und in den Vogesen sowie dem benachbarten Schwarzwald, im Fichtelgebirge und Erzgebirge sowie im Bayerischen Wald.
Nadelbaum trifft die Sache bei der Bergkiefer nur unvollkommen – die rauen natürlichen Standorte haben dafür gesorgt, dass aus dem Baum oft ein niederliegender großer Strauch wird. Sie ist ein- oder mehrstämmig und bildet eine breit kegelförmige, lockere Krone, die eine Höhe von über 25 Metern erreichen kann und bis zu 40-50 Zentimeter dicke Stämme bildet. Keine Bange, die meisten Bergkiefern werden im heimischen Garten gerade mal um die fünf Meter hoch und etwa ebenso breit.
Die reich verzweigten Äste stehen bei den baumartig wachsenden Berg-Föhren etagenförmig quirlig und aufrecht oder bogenförmig aufsteigend. Bei den strauchartigen Formen wachsen sie recht unregelmäßig.
Charakteristisch ist die graubraune bis schwarzgraue dicke und längsrissige Borke, die sich an alten Stämmen schuppig ablöst. Junge Triebe sind olivgrün bis hellbraun, kahl und gefurcht, mit zunehmendem Alter werden sie violettbraun bis schwarzbraun. Die zylindrischen Winterknospen werden 1-1,6 Zentimeter lang; sie sind stumpf oder gespitzt, mit am Rand gefransten Knospenschuppen und reichlich mit klebrigem Harz bedeckt.
An jedem Kurztrieb stehen zwei steife, 2-8 Zentimeter lange und 1,2-3 Zentimeter breite dunkelgrüne Nadelblätter. Ihr Ende ist spitz, der Rand sehr fein gesägt, im Querschnitt haben sie eine halbrunde Form. Ihren Grund bildet eine gemeinsame graubraune, oben silbrig glänzende Nadelscheide von etwa einem Zentimeter Länge. Anfangs liegen die jungen Nadeln den Zweigen beinahe an, danach spreizen sie sich zusehends ab, bis sie fast rechtwinklig abstehen. Die feinen Spaltöffnungsstreifen sind über die ganze Blattoberfläche gleichmäßig verteilt.
Die Bergkiefer ist einhäusig und bildet ihre männlichen und weiblichen Blüten auf den gleichen Pflanzen. Dabei erscheinen die männlichen Blüten am Grund der jungen Langtriebe in den Achseln der Schuppenblätter, wo sonst die Kurztriebe herauskommen. Sie sind zylindrisch, 1-2 Zentimeter lang und durch den reichlich gebildeten Pollen gelb. An den Enden der gleichen Langtriebe erscheinen die weiblichen Blütenstände allein oder in kleinen Gruppen von bis zu vier Exemplaren. Sie stehen aufrecht und sind 5-10 Millimeter lang, hellrosa bis rot gefärbt.
Im ersten Jahr verändern sich die weiblichen Blütenstände kaum; erst im zweiten Jahr wachsen sie aus und beginnen zu reifen. Dabei verbiegen sie sich seitlich oder suchen eine hängende Stellung. Die daraus gebildeten verholzenden Zapfen sind ausgesprochen vielgestaltig – mal sind sie symmetrisch, mal mehr oder weniger asymmetrisch, 3-7 Zentimeter lang und geöffnet 2-6 Zentimeter breit. Die Schuppenschilde weisen einen großen Nabel, teils mit Dorn und bisweilen einem dunklen Ring auf. Im Inneren der Zapfen bilden sich die 4-5 Millimeter großen Samen, die einen 1-2 Zentimeter langen und fünf Millimeter breiten Flügel besitzen. Reif werden sie im Oktober und November – wohlgemerkt des Folgejahres.

Die Berg-Kiefer kommt mit geradezu erschreckend vielen Substraten zurecht – am besten achtet man noch mal zusätzlich darauf, welche Sorte oder Unterart man erwischt hat. Sie sind mehr oder weniger geeignet für saure bis alkalische, trockene bis feuchte, sandige bis torfige Böden. Die Überlebenskünstler wollen auf jeden Fall reichlich Sonne und eine möglichst wasserdurchlässige Erde haben, denn wenigstens mit Staunässe kann man sie einigermaßen zuverlässig umbringen.
Schneiden braucht man bei der Bergkiefer normalerweise nur, wenn man sie in Form bringen will. Ansonsten wächst sie völlig unbehelligt am schönsten. Natürlich kannst Du jederzeit tote trockene Äste absägen.
Alte Bäume der Bergkiefer bilden reichlich Samen. Das Saatgut bleibt über vier Jahre keimfähig und keimt danach immer noch zu 50-90 Prozent aus. Wenn Du Dich im Frühjahr an der Aussaat versuchen möchtest, erkennst Du die Sämlinge an ihren 4-6 dünnen Keimblättern. Ansonsten pflegt man die Bergkiefer als jungen Baum im Gartencenter oder in der Baumschule zu kaufen, das macht am wenigsten Arbeit. Dabei geht das mit dem Wachstum der Bäumchen recht schnell: Sie blühen bereits nach 6-10 Jahren.
Mit ihrem eher niedrigen Wuchs sind die verschiedenen Sorten der Bergkiefer vor allem für Steingarten und Heidegarten geeignet. An geeigneten Stellen lassen sich daraus auch anspruchslose Hecken ziehen, die an Hängen und Böschungen den Boden festigen. Hervorragend machen sie sich auch zusammen mit Rosen und mit Rhododendron. Die besonders kleinen Sorten eigenen sich auch als Kübelpflanzen für den Balkon oder die Terrasse.
Im Garten ist die Bergkiefer eigentlich kaum kaputtzukriegen – außer mit Staunässe und zu gut gemeinten Düngegaben. Schädlinge wie Fichtenläuse, Blattläuse und Kiefernrost plagen sie weniger als die anderen weniger widerstandsfähigen Pinus-Arten.
Noch am häufigsten tritt der Kiefern-Blasenrost (Cronatium ribicola) auf, ein Rostpilz, der sich auch an Weymouth-Kiefer und Johannisbeeren findet, vor allem bei der Schwarzen Johannisbeere. Bei Kiefern äußert er sich mit spindelförmig angeschwollenen Trieben und vergilbenden Nadeln. Mit der Zeit sterben die betroffenen Äste ab, und letztlich kann der ganze Baum daran verenden. Hier müssen die betroffenen Zweige großzügig entfernt, notfalls die kompletten Bäume gerodet und entsorgt werden. Nur nicht über den Kompost, denn da können die Pilzsporen überleben.
In den Gebirgen Europas machen den natürlichen Bestände Schimmelpilze zu schaffen, vor allem der Schwarze Schneeschimmel (Herpetotrichia nigra). Er fühlt sich in der feuchten Luft unter der Schneedecke besonders wohl und schädigt die Blätter, sodass sie gelb werden und abfallen. Zwischendurch braucht der ungebetene Pilz einen anderen Zwischenwirt, nämlich den Wacholder.
Für die Bestäubung der Bergkiefer sorgt der Wind, der den reichlich gebildeten Pollen über weite Strecken zur nächsten Blüte transportiert. Insekten gehen hier also mangels Nektar leer aus. Dafür freuen sich Nachtfalter über das Raupenfutter: Der Kiefernspinner (Dendrolimus pini) und die Kieferneule (Panolis flammea) legen hier ihre Eier ab. Bei massenhafter Vermehrung gelten beide als Schädlinge, die ganze Wälder kahlfressen können.
Die Bergkiefer ist extrem anpassungsfähig und kommt aus basischen wie sauren, trockenen sandig-felsigen wie auch torfhaltigen und frischen Böden vor. Ihre Anpassungsfähigkeit hat es ihr erlaubt, auch an den extremen Standorten der alpinen Höhenstufe ihre ökologische Nische zu finden. Das zeigt sich selbst oberhalb der Waldgrenze, wo andere Gehölze den Geist aufgeben und die tapfere Bergföhre oftmals große Reinbestände bilden kann. Andernorts teilt sie ihren Standort mit anderen bergbewohnenden Kleingehölzen wie Alpenrose und Grün-Erle und bildet die typischen Latschen- oder Krummholzgürtel. Oder sie wächst in Hochmooren zusammen mit Rauschbeere und Torfmoosen.
In den Alpen und anderen Gebirgsregionen Europas ist die Latsche oder Legföhre ein wichtiger Bodenfestiger, der den Abgang von Lawinen verhindert. Zudem sind die Zweige und Äste extrem elastisch und belastbar, sodass sie auch über längere Zeiträume große Schneemassen ertragen. Andere Gehölze müssen bei einer derart beispiellosen mechanischen Belastung passen. Die Bergkiefer hält nicht nur Geröll, Schnee und Eis stand, sondern auch scharfen und kalten Winden, die sonst den meisten größeren Pflanzen den Garaus machen.
Erstaunlicherweise ist die Bergkiefer heute in den Alpen deutlich häufiger als früher – das liegt vor allem am Abholzen der Konkurrenz, allen voran der Lärche und Zirbelkiefer. An ihrer Stelle macht sich die Latsche breit.
Pinus ist der alte lateinische Name für die Kiefer, und mugo lautet der Name der Bergkiefer auf italienisch. Die Bäume werden über 100 Jahre alt, die Unterart uncinata, auch als Hakenkiefer bezeichnet, sogar bis zu 300 Jahre.
Die Berg-Föhre ist dank der regionalen Trennung ihrer Vorkommen extrem vielgestaltig geworden, sodass man zahlreiche geographische Sippen unterscheiden kann. Was davon als Unterart, Varietät oder wie auch immer zu bezeichnen ist, darüber streiten die Botaniker seit Jahren. Selbst die recht charakteristischen Zapfen, die bei den regionalen Vorkommen wenigstens ein erstes wichtiges Unterscheidungsmerkmal liefern sind an ein und demselben Baum oft so unterschiedlich im Detail, dass auch sie selten eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.
Im Gartenfachhandel bekommt man neben der Wildform Pinus mugo ssp. mugo vor allem die Hakenkiefer Pinus mugo ssp. uncinata, die meist als eigene Art Pinus uncinata geführt wird. Beliebt sind auch Sorten wie
Die wichtigsten Unterarten, Varietäten oder wie auch immer man sie ansieht:


| Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| BergkieferPinus mugoWildform | buschig, ausladend 50 - 500 cm 50 - 600 cm | | ||
| Bergkiefer 'Allgäu'Pinus mugo 'Allgäu' | kugelig, sehr kompakt, langsam wachsend 50 - 80 cm 50 - 100 cm | | ab 56,20 € | |
| Bergkiefer 'Benjamin'Pinus mugo 'Benjamin' | kompakt, dicht, langsam wachsend 40 - 60 cm 60 - 80 cm | | ab 37,30 € | |
| Berg-Kiefer 'Carsten'Pinus mugo 'Carsten' | aufsteigende Zweige, dicht, kompakt, breit kissenförmig 2 - 3 m | | ab 48,90 € | |
| Kriechkiefer 'Gnom'Pinus mugo 'Gnom'kegelförmig dicht verzweigter Wuchs, tief dunkelgrüne Nadelfärbung | dicht, kompakt 2 - 3 m 2 - 2,5 m |
| ||
| Hakenkiefer 'Heideperle'Pinus mugo 'Heideperle' | gut verzweigter kleiner Baum, buschig, aufrecht 60 - 80 cm 40 - 60 cm | | ab 37,30 € | |
| Berg-Kiefer 'Hesse'Pinus mugo 'Hesse'abgeflachter, kugeliger Wuchs, gedrungen, Endknospen stark harzig, frischgrüne Nadelfärbung | abgeflacht, kugelig 50 - 90 cm 1 - 1,5 m |
| ||
| Berg-Kiefer 'Humpy'Pinus mugo 'Humpy'unregelmäßig, flacher kissenförmiger Wuchs, sehr kompakt, grün - graugrüne Nadelfärbung | unregelmäßig, flacher kissenförmiger Wuchs 50 - 80 cm 50 - 100 cm | | ab 59,70 € | |
| Zwergbergkiefer ‘Laurin‘Pinus mugo 'Laurin'breitstrauchig bis halbkugelig, dicht verzweigter Wuchs, grün - dunkelgrüne Nadelfärbung | breitstrauchig bis halbkugelig, dicht verzweigter Wuchs 1,5 - 2 m 1,5 - 2 m |
| ||
| Zwergbergkiefer ‘Lilliput'Pinus mugo 'Lilliput'halbkugelig, kompakt im Wuchs, grün bis graugrüne Nadelfärbung | kissenförmig, kompakt 30 - 60 cm 20 - 50 cm |
| ||
| Zwergkiefer 'March'Pinus mugo 'March' | kompakt 90 - 120 cm 60 - 80 cm | | ||
| Kugel-Kiefer 'Mops'Pinus mugo 'Mops' | kugelig bis leicht kissenförmig 50 - 150 cm 50 - 150 cm | | ab 33,50 € | |
| Berg-Kiefer 'Wintergold'Pinus mugo 'Winter Gold'breit aufrecht im Wuchs, reich verzweigt, grün im Winter leuchtend hell bis goldgelbe Nadelfärbung | ausladend, mehrstämmig wachsender Großstrauch 1 - 1,5 m 1,5 - 2 m |
| ||
| Bergkiefer 'Wintersonne'Pinus mugo 'Wintersonne' | buschig, kugelförmig 30 - 50 cm 30 - 50 cm |
| ab 66,90 € | |
| Krummholz-KieferPinus mugo var. pumilio | kissenförmig, rundlich 1 - 1,5 m 2 - 3 m | | ab 8,90 € |
Das kommt auf die Sorte oder Unterart an. Die Bergkiefer ist von Haus aus sehr vielgestaltig und wächst entweder als bis zu 25 Meter hoher Baum mit einem halbmeterdicken Stamm oder als Strauch, der meist nur eine Höhe von etwa fünf Metern erreicht. Viele der im Gartenfachhandel erhätlichen Sorten wie ‚Gnom‘ und ‚Mops‘ bleiben noch deutlich kleiner und werden keine zwei Meter hoch. Gerade die kleineren Sorten sind auch für Stein- und Heidegärten oder als Hecken beliebt. Die größeren sind ideale Begleiter von Rosen und Rhododendron.
Kommt darauf an wohin. Mit der Bergkiefer aka Pinus mugo findet man eigentlich immer etwas Passendes. Da gibt es Varianten, die sich als bis zu 25 Meter hoher Baum ziehen lassen, was sie zu idealen Solitärbäumen für größere Gärten macht. Andere sind deutlich kleiner und lassen sich als Hecken ziehen. Einige Sorten werden keine zwei Meter hoch und machen sich im Heidegarten und Steingarten ausgezeichnet. Die mittelgroßen strauchartig wachsenden Bergkiefernsorten machen sich gut zusammen mit Rosen und Rhododendren. Ein großer Vorteil: Es gibt die Bergkiefern nicht nur in allen Größen, sie vertragen auch alles Mögliche an Substrat, das sandig, steinig, lehmig oder tonig, sauer-humos bis kalkhaltig-basisch, eher feucht oder eher trocken sein darf. Wichtig ist nur eine durchlässige Erde und reichlich Sonne.
Egal für was für eine Sorte von Bergkiefer man sich entscheidet, der Turbo sind sie alle nicht. Die meisten werden nicht so groß wie die riesigen, 25 Meter hohen Bäume, sondern bleiben deutlich kleiner mit fünf Metern oder sogar noch weniger. Dabei legen sie alle nur etwa eine Handbreit pro Jahr zu – also so etwas um die zehn Zentimeter. Mit dem Blühen geht das wesentlich schneller: Eine aus Samen gezogene Bergkiefer blüht bereits nach 6-10 Jahren zum ersten Mal.
Über das Alter der Bergkiefer liest man im Internet lustige Dinge. Über fünf bis zehn Jahre können die meisten nur lachen – das gilt bestenfalls für einige niedrige Sorten, die einen ziemlich üblen Standort erwischt haben. Und das will bei einer Bergkiefer schon etwas heißen – einige davon wachsen in den Alpen oberhalb der Baumgrenze, wo anderes Gehölz keine Chance hat. Die überaus elastischen Äste widerstehen Schutt, Geröll, Eis und Schnee und sind nicht kaputtzukriegen. Zumindest nicht in zehn Jahren. Wenn es Mutter Natur mit ihnen nicht übertreibt werden sie über 100 Jahre alt, einige besonders langlebige Hakenkiefern, eine spezielle Unterart der Bergföhre, hatten nach ihren Jahresringen zu urteilen bereits ein stolzes Alter von 200-300 Jahren.
Kommt auf die Bergkiefer an. Die meisten kommen mit jedem durchlässigen Boden mit reichlich Sonne zurecht. Ansonsten solltest Du Dich bei Deinem Gärtner oder bei uns in der NaturaDB erkundigen, welcher Boden für die jeweilige Sorte am besten geeignet ist. Da ist die Spanne groß: Einige natürliche Standorte liegen im sauren torfigen Hochmoor (so bei der Moorspirke Pinus mugo ssp. rotundata), andere in den Krummholzgürteln oberhalb der Waldgrenze auf steinigem Geröll (die „echte“ Legföhre Pinus mugo ssp. mugo) oder auf basischem Kalk-, Dolomit- und Granitboden (Hakenkiefer, Pinus mugo ssp. uncinata).
Bergkiefer ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Schmetterlinge und Schmetterlingsraupen