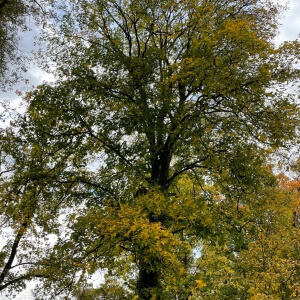https://www.naturadb.de/pflanzen/lonicera-periclymenum/

| Licht: | Halbschatten |
| Boden: | humos |
| Wasser: | feucht bis frisch |
| Nährstoffe: | nährstoffarmer Boden |
| PH-Wert: | sauer |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | kletternd, Schlinger |
| Höhe: | 3 - 6 m |
| Breite: | 1 - 1,5 m |
| Zuwachs: | 20 - 60 cm/Jahr |
| schnittverträglich: | ja |
| frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
| Wurzelsystem: | Herzwurzler |
| Blütenfarbe: | weiß |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | köpfchenförmig, röhrenförmig |
| Blütenduft: | ja (Honig) |
| Fruchtreife: | |
| Fruchtfarbe: | rot |
| Fruchtaroma: | giftig |
| Blattfarbe: | dunkelgrün |
| Blattform: | breit-eiförmig, ganzrandig, elliptisch |
| Blatt aromatisch: | ja (Honig) |
| Bestandssituation (Rote Liste): | häufig |
| Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
| Wildbienen: | 3 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
| Schmetterlinge: | 9 |
| Raupen: | 35 (davon 3 spezialisiert) |
| Käfer: | 1 |
| Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
| Pollenwert: | 2/4 - mäßig |
floraweb.de.
| Höhenlage: |
planar (<100m1 / <300m)2 bis montan (500m-600m1 / 800m-1200m)2 1 Mittelgebirge / 2 Alpen |
| ist giftig: | Früchte leicht giftig |
| Pflanzen je ㎡: | 1 |
| Stütze: | Pflanze benötigt eine Stütze oder kräftige Pflanzpartner |
|
Eignung im Hortus: Was bedeutet Hortus? |
gut geeignet für Pufferzone |
Anzeige*

Heimische Wildpflanzen sind vielerorts selten geworden und damit die neuen Exoten in unseren Gärten. Sie sind, im Gegensatz zu Neuzüchtungen und Neuankömmlingen, eine wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen und Schmetterlinge. In puncto Stand- und Klimafestigkeit sind sie anderen Arten deutlich überlegen. Auch kalte Winter überleben sie meist ohne Probleme. Gut für dich, gut für die Natur.
Also pflanzt heimische Arten, so wie diese!
Deutsches Geißblatt, Wildes Geißblatt oder Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum) ist der bei uns am häufigsten wild vorkommende Vertreter der Geißblätter aus der Familie der gleichnamigen Geißblattgewächse (Caprifoliaceae). Es wächst in Europa und der Türkei bis zum Kaukasus sowie in Nordafrika. In Deutschland trifft man den beliebten Zierstrauch ziemlich häufig in Eichenwäldern mit Birken und Hainbuchen, Erlenwaldgesellschaften, auf Waldlichtungen und an Waldrändern an.
Es handelt sich dabei um eine wüchsige verholzende Kletterpflanze mit tiefreichendem Wurzelsystem, die sich an benachbarten Strukturen bis zu sechs Meter hoch emporwindet und im Winter ihr Laub abwirft. Die Triebe haben lange Internodien und nicht verdickte Knoten; sie sind anfangs rötlich und kurz weich behaart, später aschgrau und mit einer faserig abschälenden Rinde bedeckt. Die paarig stehenden Blätter sind ebenfalls anfänglich unterseits haarig und bereift, später kahl, oval-eiförmig bis verkehrt-eiförmig und bis sechs Zentimeter lang. Ihr Rand ist meistens glatt, selten fein gezähnt, die Oberseite dunkelgrün und die Unterseite heller blaugrün.
Im Hochsommer erscheinen endständig langgestielte dreiblütige Dichasien mit stark duftenden und bis zu fünf Zentimeter langen Blüten, die bei dieser Art zwischen zwei nicht miteinander verwachsenen kleinen Hochblättern stehen. Sie sind fünfzählig, zwittrig und zygomorph zu einem 2,5 Zentimeter langen schmalen Rohr mit Unterlippe und vierteiliger Oberlippe verwachsen, gelb oder weiß und rot überlaufen. Die fünf Staubblätter ragen weit über die Kronröhre hinaus. Nach der Bestäubung reifen sie zu eiförmigen, acht Millimeter großen hellroten Beeren mit einigen wenigen Samen heran. Letztere sind oval, vier Millimeter lang und drei Millimeter breit, mit einer glänzenden welligen orangebraunen Oberfläche.

Das Deutsche Geißblatt bevorzugt einen mäßig frischen bis feuchten nährstoff- und kalkarmen, aber basenreichen mäßig sauren bis sauren torfigen, humosen oder sandigen Lehmboden. Es steht am liebsten im Halbschatten, wo es am zuverlässigsten blüht; die Wurzeln sollten auf jeden Fall nicht in der prallen Sonne, sondern eher kühl liegen.
Beim Bewachsen umliegender Bäume und Sträucher sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Pflanze zu einer enormen Belastung heranwachsen kann, denen einige Äste in schneereichen Wintern oft nicht zu widerstehen vermögen. Nahe am Haus gepflanzt erfreuen die Blüten bis in den Herbst hinein Augen und Nase.
Ein Schneiden wird beim Wald-Geißblatt erforderlich, wenn es sich zu sehr ausbreitet und die von ihm berankten Sträucher und Bäume bedrohlich einschränkt. Tote Triebe kann man im Frühjahr entfernen, und alle paar Jahre sorgt ein kräftiger Verjüngungsschnitt für buschig und blühwillig bleibende Pflanzen.
Eine Vermehrung ist mit Samen möglich, oder man schneidet im Frühling oder Winter Stecklinge vom alten Holz. Ebenso kann man von niederliegenden Trieben Absenker machen, indem man einen Stein darauflegt und sie Wurzeln ziehen lässt.
Das Deutsche Geißblatt ist eine beliebte Zierpflanze, mit der sich Hecken, Zäune, Mauern und Pergolen begrünen lassen. Die duftenden Blüten sind auch deshalb beliebt, weil sie lange halten und bis zum Herbst blühen.
Die Pflanzen gelten als recht robust und widerstandsfähig und haben nur selten mit Krankheiten und Schädlingen zu tun. Nur Blattläuse finden sich regelmäßig an den jungen Blättern und Blüten, und bisweilen treten Rostpilze wie Puccinia und Aecidium auf. Schädlich wird das Geißblatt eher umliegenden Gewächsen, wenn es ihnen mit überbordendem Wachstum Licht, Luft und Nährstoffe entzieht.
Die Bestäubung erfolgt vor allem durch Nachtfalter, die sich an den vor allem gegen Abend hin immer intensiver duftenden Blüten einfinden und die einen ausreichend langen Rüssel aufweisen, mit dem sie bis in den nektarreichen Grund vordringen können. Dazu gehören unter anderem der Kiefernschwärmer (Hyloicus pinastri) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpinus). Insgesamt interessieren sich neun Schmetterlinge für die Pflanzen, vor allem in Form von Raupenfutter wie bei Maivogel (Euphydrias maturna) und Kleinem Eisvogel (Limenitis camilla).
Erreicht der Nektar in den Röhrenblüten seinen Höchststand, können ihn auch Hummeln erreichen. Manchmal machen hungrige Honigbienen und Hummeln kurzen Prozess und knabbern die Kronröhren seitlich auf, um an den nahrhaften Saft im Inneren zu gelangen. Den Pollen sammeln unter anderem Schwebfliegen ein.
Die Verbreitung der Samen übernehmen Vögel, die sich an den roten Beeren gütlich tun. Dazu zählen vor allem Krähenvögel, Singdrosseln, Dompfaff und Grasmücken. Regional wurden die Beeren früher an die Hühner verfüttert. Die Verdauung beschleunigt die Keimung. Zudem bauen viele kleinere Singvögel mit Vorliebe ihre Nester in dichte Bestände des Wald-Geißblattes und verwenden zu deren Bau auch die faserig ablösende Rinde.
Ähnliches tun auch Siebenschläfer, Haselmäuse und andere Schlafmäuse, die damit die Sommernester für ihre Jungen polstern; zudem verwenden auch sie den Nektar als schnell verfügbare Energiequelle.
Das Deutsche Geißblatt ist übrigens ein Rechtswinder. Die Blüten riechen vor allem in den Abendstunden und nachts intensiv nach einer Mischung aus Lilien, Vanille und Holz. Den Namen hat es bekommen, weil die jungen Blätter zu den Lieblingsspeisen von Ziegen gehören. Der Legende nach sollen die Pflanzen vor dem Teufel schützen.
Neben der Wildform gibt es im Gartenfachhandel noch etliche Zuchtsorten, bei denen die Blüten noch prächtiger gefärbt sind, länger blühen oder noch intensiver duften.
Die süßen roten Früchte gelten als leicht giftig und sind vor allem für Kinder verlockend; sie führen anfangs zu Schweißausbrüchen mit erweiterten Pupillen und tränenden Augen, später zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen, in höheren Dosen zu Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen, schlimmstenfalls Koma und Tod. Dafür sind aber erhebliche Mengen erforderlich.
Den lateinischen Namen hat Lonicera vom deutschen Botaniker Adam Lonitzer (1528-1586), der unter seinem lateinischen Pseudonym Lonicerus ein bekanntes Kräuterbuch verfasste. Auch das Deutsche Geißblatt ist eine alte Heilpflanze, die in diesem und vielen anderen Traktaten Erwähnung findet. Die Rinde nutzt man seit alters her als Diuretikum, die Beeren zur Wundheilung und die Blätter und kurz vorm Öffnen geernteten Blüten gegen Erkältungen mit Husten und Bronchitis, Asthma, Herzrasen, Schlaflosigkeit und Schluckauf.


| Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches GeißblattLonicera periclymenumWildform | kletternd, Schlinger 3 - 6 m 1 - 1,5 m |
| ab 12,10 € | |
| Deutsches Geißblatt 'Graham Thomas'Lonicera periclymenum 'Graham Thomas'winterhart, anspruchslos | kletternd, schlingend 3 - 4 m 1,5 - 2,5 m |
| ab 12,10 € | |
| Wald-Geisschlinge 'Loly'Lonicera periclymenum 'Loly'rahmgelbe bis dunkelgelbe Blüten | kletternd, Schlinger 3 - 5 m 1 - 3 m |
| ||
| Wald-Geisschlinge 'Serotina'Lonicera periclymenum 'Serotina'schöner Fruchtschmuck | kletternd, Schlinger 3 - 4 m 1,5 - 2,5 m |
| ab 12,10 € |
Am naheliegendsten ist der Kauf in einer Gärtnerei oder einer Baumschule deiner Region.
Unter "Deutsches Geißblatt kaufen" findest du sofort erhältliche Angebote unterschiedlicher Internet-Anbieter.
Das Wald-Geißblatt oder Deutsches Geißblatt Lonicera periclymenum enthält Tannine, Flavonoide, Schleimstoffe, Salicylsäure und Glykoside wie Lonicerosid. Es ist eine alte Heilpflanze, die man bereits in der Antike kannte; Plinius d. Ä. verwendete Geißblatt in Wein gegen Erkrankungen von Leber und Milz. Im Mittelalter bereitete man aus der Rinde einen harntreibenden Tee, aus Blüten und Blättern einen Aufguss gegen Erkältungskrankheiten und Asthma, der zudem gegen Herzrasen und Schluckauf helfen und den Schlaf fördern sollte. Die Beeren sind ein altes Mittel zur Wundheilung, Brechmittel und Abführmittel. In größeren Mengen sind vor allem die Beeren schwach giftig. Wegen der stark schwankenden Konzentrationen der biologisch aktiven Inhaltsstoffe wird die Arzneipflanze von der Naturheilkunde heute praktisch nicht mehr genutzt.
Wald-Geißblatt oder Deutsches Geißblatt ist zwar eine alte Heilpflanze, aber alles andere als ungiftig. Die verführerischen roten süßen Beeren haben es insbesondere Kindern angetan. Sie sorgen für erweiterte Pupillen, Schweißausbrüche und tränende Augen, in höheren Dosen zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Letztlich kommt es zu Krämpfen, Herzrhythmusstörungen und schlimmstenfalls komatösen Zuständen und Tod durch Kreislaufversagen. Die gute Nachricht: Die charakteristischen Blüten mit ihrem süßen Nektar kann man in kleinen Mengen bedenkenlos genießen.
Deutsches Geißblatt ist in Mitteleuropa heimisch und Nahrungsquelle/Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Schmetterlingsraupen