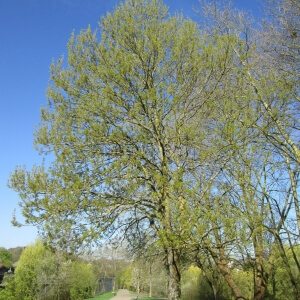https://www.naturadb.de/pflanzen/ficus-carica/?thema=91

| Licht: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | durchlässig bis humos |
| Wasser: | frisch bis trocken |
| Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
| Kübel/Balkon geeignet: | ja |
| Pflanzenart: | Gehölz |
| Wuchs: | sparrig, Strauch oder kleiner Baum |
| Höhe: | 3 - 4 m |
| Breite: | 3 - 4 m |
| Zuwachs: | 20 - 40 cm/Jahr |
| frostverträglich: | bis -17 °C (bis Klimazone 7) |
| Wurzelsystem: | Herzwurzler |
| Blütenfarbe: | grün |
| Blühzeit: | |
| Blütenform: | unscheinbar |
| Fruchtreife: | |
| Fruchtfarbe: | grünlich, bräunlich oder violett |
| Fruchtaroma: | süß, wohlschmeckend |
| Blattfarbe: | grün |
| Blattform: | gelappt, glänzend |
| ist essbar |
Früchte Verwendung: roh oder getrocknet zum direkten Verzehr, zu Vorspeisen u. Desserts |
| Pflanzen je ㎡: | 1 |
| Jahreszeitlich Aspekte: | Herbstfärbung |
Anzeige*
Die Echte Feige, Kulturfeige, Essfeige (Ficus carica) oder genauer der Echte Feigenbaum gehört zur Familie der Maulbeergewächse (Moraceae) und wird mittlerweile in den tropischen und subtropischen sommertrockenen Regionen der Erde weltweit kultiviert. Ursprünglich beheimatet ist er am Mittelmeer bis hinüber nach Indien und auf den Kanarischen Inseln, wo er in felsigen Regionen und der mediterranen Garrigue wächst.
Der Feigenbaum ist ein 3-4 Meter hoher sommergrüner Baum oder mehrstämmiger Strauch mit einer ausladenden Krone, glatten silbergrauen Borke und auffällig dicken Ästen. Die typischen handförmig 3-5-lappigen, im Umriss rundlichen Feigenblätter erscheinen erst spät im Jahr; ihre Oberseite ist rau, die Unterseite weich behaart. Sie werden 10-24 Zentimeter lang und haben einen herzförmigen Grund unmittelbar vor dem Blattstiel.
Die kleinen und unscheinbaren Blüten der Feigenbäume wird man nur mithilfe eines Messers zu Gesicht bekommen, denn sie verstecken sich in den grünen fleischigen und birnförmigen Blütenständen, die vor allem aus der vergrößerten Blütenstandsachse bestehen und später zu den charakteristischen 5-10 Zentimeter großen gelben, purpurnen oder braunvioletten Früchten heranreifen. Bei den darin befindlichen kleinen braunen Samen handelt es sich botanisch um Achänen. Die Fruchtschalen sind je nach Sorte unterschiedlich dick.

Im Freiland gedeiht der Feigenbaum bei uns nur in den wärmeren Regionen wie den klassischen Weinbaugebieten an Rhein, Mosel und Nahe. Draußen braucht er einen frischen humosen und gut durchlässigen Boden mit reichlich Sonne und Wärme, zumindest aber Halbschatten. Insbesondere im Winter muss er vor kalten austrocknenden Winden geschützt werden. Jährliches Mulchen fördert das Wachstum.
Bei Haltung im Gewächshaus oder im Wintergarten kannst Du eine lehmhaltige Topferde mit Rindenstückchen zur besseren Drainage verwenden. Als Kübelpflanze ist die Echte Feige für viel Wärme, Licht und ab und zu etwas stickstoffreichen Dünger dankbar. Im Winterstand muss man sie nur leicht feucht halten, völlig austrocknen sollte der Boden nicht.
Viel schneiden wird man bei der Echten Feige in unseren Breiten eher nicht. Gegebenenfalls entfernt man schiefe, parallele und überkreuzende Äste.
In der Regel wird man auf einen jungen Feigenbaum aus dem Gartenfachhandel zurückgreifen, wenn man sich ein Exemplar davon in den Garten oder in Kübel und Container auf Balkon und Terrasse stellen möchte. Dabei ist eine Vermehrung mit Samen durchaus möglich – aber dieses Geduldsspiel möchte man sich in unseren Breiten normalerweise nicht antun.
Hast Du bereits einen Feigenbaum parat, kannst Du im Frühling oder Sommer halbverholzte Stecklinge oder Blattaugenstecklinge schneiden. Sie bewurzeln allerdings nur mit Bodenheizung einigermaßen zuverlässig. Die Sorten der Echten Feige kann man ohnehin nur vegetativ vermehren.
Feigenbäume glänzen in unseren Breiten weniger mit einer reichlichen Ernte als mit ihren dekorativen sprichwörtlichen Feigenblättern. Dessen ungeachtet können auch die bei uns eher selten im Freien stehenden Exemplare auch Früchte ansetzen – sogar wenn man sie als Kübelpflanze oder als Topfpflanze hält. Allerdings setzt das eine Selbstbefruchtung voraus; normalerweise funktioniert das in der freien Natur nur mittels bestäuberischer Hilfe der Feigenwespe. Im Freiland sind sie in deutschen Gärten eher eine Sensation und stehen daher in aller Regel als Solitär.
In den seltenen Fällen, wo eine Echte Feige in unseren Gärten im Freiland gehalten werden kann, wird man darauf kaum jemals Schädlinge oder Krankheiten beobachten; viele der in ihrer Heimat verbreiteten Schadinsekten kommen bei uns schlichtweg nicht vor. Der im Mittelmeerraum häufige, gerade mal zwei Zentimeter große Feigen-Spreizflügelfalter (Choreutis nemorana), dessen Raupen an den Blättern fressen, tritt bei uns nur selten auf.
Unter Glas im Wintergarten oder im Gewächshaus sieht das etwas anders aus; hier können sich etliche lästige Besucher einstellen, die sich notfalls auch mit dem Feigenbaum anfreunden. Zu den ungebetenen Gästen gehören vor allem Spinnmilben, Thripse, Schmierläuse und Schildläuse.
Die Bestäubung der Wildform des Feigenbaums ist recht außergewöhnlich, denn sie wird von speziellen Gallwespen vorgenommen. Diese Feigengallwespen (Blastophaga psenes) sind winzige, nur 1-2 Millimeter große Hautflügler. Schaut man in eine junge Feige hinein, erkennt man dort streng genommen drei Sorten von Blüten: männliche, weibliche und Gallblüten. Bei Letzteren hat sich der Fruchtknoten dank des bei der Eiablage abgesonderten Sekretes aus den Genitaldrüsen eines Gallwespenweibchens durch Wucherung des Gewebes zu einer Galle vergrößert.
Eine Selbstbestäubung ist eigentlich ausgeschlossen, denn die männlichen Blüten reifen erst nach den weiblichen. Zur Samenbildung kommt es, weil die geflügelten weiblichen Gallwespen bei ihren Besuchen zur Eiablage den Pollen von einer Jungfeige zur nächsten übertragen. Der komplette Lebenszyklus vom Ei bis zum geschlechtsreifen Tier vollzieht sich in den Gallblüten, die selbst keine Samen bilden. Das tun die weiblichen Blüten nebenan. Die männlichen Tiere entwickeln sich in anderen Fruchtknoten; sie sind auf reine Vermehrung reduziert, heißt als ausgewachsene Gallwespenmännchen haben sie keine Flügel, einen nur rudimentären Darm und sind fast blind. Sie sehen gerade genug, um die Weibchen zu begatten.
Zu dieser Zeit sind die männlichen Blüten reif, und die begatteten Feigenwespenweibchen fliegen mit Pollen bepudert über die einzige natürliche Öffnung an der Spitze der Frucht davon. In die nächste Frucht dringen sie über das winzige Loch am Ende ein und übertragen dabei den Blütenstaub auf die hier gerade reifen weiblichen Blüten.
Übrigens wurden auch die Gallblüten selbst vorher bestäubt – ansonsten fehlt ihnen der Stimulus, mit dem der Fruchtknoten zu einer für die Eiablage geeigneten Größe heranwächst. In unbestäubten Blüten können sich nur eher selten die kleineren männlichen Wespen entwickeln.
Interessant ist die Anpassung der Feigenblüten an die Legegewohnheiten der Feigengallwespen: Diese führen ihre Eier mittels einer speziellen Legeröhre über den Griffelkanal in den Fruchtknoten ein. Blüten mit langen Griffeln sind vor der Eiablage geschützt und können so ungehindert heranwachsen, während die kurzgriffeligen Blüten daneben extra für die Bestäuber vorgesehen sind und sich zu Gallblüten entwickeln.
Bei der Kulturfeige wird es endgültig kompliziert, indem diese unterschiedlichen Blüten auf getrennten Individuen ausgebildet werden: Die einen bergen Blütenstände mit Gallblüten und einige Pollenblüten strategisch günstig in der Nähe des Ausgangs, andere nur samenbildende weibliche Blüten. Erstere bezeichnet man als Bocksfeigen oder Ziegenfeigen (Caprificus), letztere als zahme Feige. Bisweilen bezeichnet man sie auch als eigene Varietäten, Ficus carica var. domestica und Ficus carica var. caprificus.
Bei den Kulturfeigen ist es für eine erfolgreiche Bestäubung seit Jahrtausenden üblich, Ziegenfeigen neben die zahmen Feigen zu pflanzen oder wenigstens einige blühende Äste in ihre Krone zu hängen. Ohne diese „Caprifikation“ gibt es – normalerweise – keine Bestäubung und auch keine Früchte. Die Feigen der Caprificus-Bäume sind übrigens klein, trocken und kaum genießbar.
In wärmeren Gegenden bilden beide Arten von Feigenbäumen drei Schübe von Früchten, wobei die Sommerfrüchte der zahmen Feige die Haupternte darstellen. Und schon wieder wird es noch komplizierter: Ein kultivierter Feigenbaum bildet dabei drei Generationen von Blütenständen: Die erste enthält Gallblüten und einige männliche Blüten, die zweite lediglich fruchtbare weibliche Blüten und die Herbstgeneration nur Gallblüten. Der Grund: Diese werden nun als Winterquartier für die nächste Generation von Feigenwespen benötigt.
Wer jetzt Angst hat, dass er grundsätzlich bei jeder Feige eine unfreiwillige Fleischbeilage mitisst: Viele der heute kultivierten Feigensorten sind Selbstbestäuber und kommen notfalls auch ohne die Hilfe der Feigenwespen zurecht.
Natürlich wäre all das vergebens, wenn die Samen der Feigen nicht verbreitet würden. Das übernehmen Vögel, Insekten und Säugetiere, die sich über die süßen Früchte hermachen.
Als Kulturpflanze ist die Echte Feige schon seit Menschengedenken bekannt; schon die alten Ägypter und Mesopotamier wussten sie zu schätzen, und in der Bibel wird sie des Öfteren erwähnt. Hier sogar als erste explizit namentlich erwähnte in der Genesis, wo Adam und Eva sich nach dem Naschen am Baum der Erkenntnis mit Feigenblatt bedeckten.
Die essbaren Früchte des Feigenbaums sind wegen ihrer Süße beliebt; man kann sie frisch oder getrocknet verzehren. In den Mittelmeerländern stellt man aus dem Feigensaft auch alkoholische Getränke in Form von Feigenwein und Feigenschnaps her. Trockenfeigen werden zu Backwerk und Desserts verarbeitet. Zudem dienen die getrockneten Feigen ähnlich wie getrocknete Pflaumen bei uns als probates, aber eher mildes Abführmittel.
Die bei uns im Handel erhältlichen getrockneten Feigenfrüchte sind oft noch besonders behandelt, etwa durch Sterilisation oder Dämpfen, damit sie besser haltbar werden. Zusammen mit Datteln sind sie die weltweit am meisten gehandelten Trockenfrüchte.
Im 18. Jahrhundert kam man in Italien, Südtirol und Österreich erstmals auf die Idee, aus getrockneten, gerösteten und anschließend gemahlenen Feigen Feigenkaffee herzustellen. Das Produkt wurde nicht nur als Kaffeesurrogat und Kaffeezusatz verwendet, sondern auch zum Würzen und zur Verbesserung der Konsistenz von Suppen und Saucen. Erstmals erwähnt wird Feigenkaffee im Jahr 1858, und 1873 nahmen die Kaffeesurrogatfabrik Otto E. Weber in Berlin (später auch in Radebeul) und Heinrich Franck Söhne in Ludwigsburg den Betrieb auf. Die Täfelchen der Ersteren waren unter der Bezeichnung Weber’s Carlsbader Kaffeegewürz weit verbreitet und bekannt. Heute ist diese Sorte „Muckefuck“ nur noch selten im Handel zu finden.
Feige leitet sich vom lateinischen ficus ab, das bereits die alten Römer für den Baum verwendeten. Der Artname carica bedeutet aus Caria/Karien stammend, einem antiken Königreich im Südwesten der heutigen Türkei.
Die Echte Feige ist der einzige Vertreter der Gattung Ficus, die man in unseren Gärten in nennenswerter Menge findet. Dabei umfasst sie über 1.000 Arten von immergrünen oder laubabwerfenden Bäumen, Sträuchern, Kletterpflanzen und Lianen, die in den ganzen Tropen und Subtropen beheimatet sind. Zu den Feigen gehören auch beliebte Zimmerpflanzen wie Gummibaum (Ficus elastica), Leier-Feige (Ficus lyrata) und Birken-Feige (Ficus benjamina). Besonders spektakuläre Verwandte sind die Würgefeigen, die an Bäumen hochwachsen und sie so fest umschlingen, dass sie letztlich mangels Licht und Nährstoffen absterben. In den oft bizarren Würgefeigen bleibt ein Hohlraum – sie sind nun groß genug und benötigen keine weitere mechanische Unterstützung.


| Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Echte FeigeFicus caricasparriger Wuchs, dekorative Blätter, Frucht essbar, nicht winterhart | sparrig, Strauch oder kleiner Baum 3 - 4 m 3 - 4 m | | süß, wohlschmeckend, grünlich, bräunlich oder violett August - September | ab 25,60 € |
| Feige 'Brown Turkey'Ficus carica 'Brown Turkey'ertragsreiche Sorte, Frucht essbar, bedingt winterhart | aufrecht, breit, gut verzweigt 2 - 4 m 3 - 6 m | | süß, mittelgroß, goldgelb bis violettbronze August - September | ab 13,40 € |
| Feige 'Califfo Blue'Ficus carica 'Califfo Blue'selbstfruchtbar, essbare Frucht, sehr süß | aufrecht, breit 2 - 3 m 2 - 3 m | | süß, aromatisch, mittelgroß bis groß, dunkelviolett bis blau August - September | |
| Feige 'Contessina'Ficus carica 'Contessina'große Frucht, gut winterhart, essbar | aufrecht, strauchartig 3 - 4 m 3 - 4 m | | süß, groß, braunviolett August | |
| Echte Feige 'Firoma'Ficus carica 'Firoma' | buschig, kompakt, aufrecht 2,5 - 3 m 2 - 3 m |
| süß aromatisch, rötlich-violett Mai - Juli | ab 13,40 € |
| Feige 'Goldfeige'Ficus carica 'Goldfeige'strauchartiger Wuchs, gelbe Früchte, essbar | aufrecht, strauchartig 3 - 4 m 3 - 4 m | | süß, mittelgroß, gelb | |
| Feigenbaum 'Gustis Ficcolino'Ficus carica 'Gustis Ficcolino'sehr kompakt wachsende Sorte | kompakt, buschig 1,6 - 1,8 m |
| süß, aromatisch, klein, gelbgrün Juni - September | |
| Echte Feige 'Little Miss Figgy'Ficus carica 'Little Miss Figgy' | kompakt, Strauch oder Busch 80 - 90 cm 80 - 90 cm | | süß, rot Mai - September | ab 13,40 € |
| Feige 'Mere Veronique'Ficus carica 'Mere Veronique'große, breite Blätter, viele Früchte, essbar | aufrecht 3 - 4 m 2 - 3 m | | süß, aromatisch, klein bis mittelgroß, hell gelb-grün August | |
| Feige 'Morena'Ficus carica 'Morena'birnenförmige Früchte, süßer, aromatische Geschmack, essbar | buschiger, stark 1 - 2,5 m 1 - 1,5 m | | süß, aromatisch, groß, rötlich-braun August | |
| Feige 'Nordland-Bergfeige'Ficus carica 'Nordland-Bergfeige'strauchartig und kompakt im Wuchs, Früchte essbar | stauchartig, kompakt 1,5 - 2 m 1,5 - 2 m | | süß, mittelgroß, violett August - Oktober | |
| Echte Feige 'Panaché'Ficus carica 'Panaché' | gut verzweigter Baum, strauchartiger Wuchs 1,5 - 3 m 1,5 - 3 m | | süß, gelb-grün Juli - September | ab 41,40 € |
| Feige 'Perretta'Ficus carica 'Perretta'sehr starkwüchsig, violette bis rotbraune Früchte | gut verzweigt, horstig, buschig 3 - 4 m 3 - 4 m | | süß, groß, violett August | ab 36,70 € |
| Echte Feige 'Precoce de Dalmatie'Ficus carica 'Precoce de Dalmatie' | gut verzweigt, strauchartig, knochig 2 - 3 m 2 - 3 m |
| süß, länglich, groß, gelbe bis smaragdgrüne Schale, rotes Fruchtfleisch | |
| Feige 'Rosetta'Ficus carica 'Rosetta'mittelgroße Frucht, essbar, liebt warme Plätze | aufrecht, strauchig 3 - 5 m 2 - 3 m | | süß, groß, rot | |
| Feige 'Rossa Rotonda'Ficus carica 'Rossa Rotonda'birnförmige Früchte, essbar | aufrecht, buschig 3 - 4 m 2 - 3 m | | süß, aromatisch, mittelgroß bis groß, dunkelblau bis schwarz August - Oktober | |
| Echte Feige 'Rouge de Bordeaux'Ficus carica 'Rouge de Bordeaux' | aufrecht, strauchartig, gut verzweigt 1,8 - 2,5 m 60 - 200 cm | | süß, birnenförmig, blauviolett, granatrotes Fruchtfleisch August | ab 36,60 € |
| Feige 'Violetta'Ficus carica 'Violetta'ertragsreich, gut winterhart, essbare Früchte | aufrecht 2 - 4 m 1,8 - 2,2 m | | süß, aromatisch, groß, violett Juli - September |
Am naheliegendsten ist der Kauf in einer Gärtnerei oder einer Baumschule deiner Region.
Unter "Echte Feige kaufen" findest du sofort erhältliche Angebote unterschiedlicher Internet-Anbieter.
Der Feigenbaum stammt ursprünglich vom Mittelmeer und aus Vorderasien, sodass ihm unser Klima nur begrenzt zusagt. Trotzdem wächst er auch bei uns im Freiland, einigermaßen winterhart ist er dabei aber nur in den wärmeren Gebieten wie den Weinbaugebieten von Rhein, Mosel oder Nahe. Manchmal hilft auch der Golfstrom – so wachsen (wenige) Feigenbäume sogar auf Helgoland in der Nordsee, allerdings nur in windgeschützten Ecken.
Naja, Todesfälle durch den Verzehr von Feigen sind unseres Wissens nicht dokumentiert. Dessen ungeachtet ist das Laub deutlich weniger verträglich – bei Verzehr kann es Magenverstimmungen und Übelkeit hervorrufen. Der weiße Milchsaft, auch der der Früchte, kann allergische Hautreizungen hervorrufen und bestehende Hautallergien verschlimmern. Nach Berührung damit kann der UV-Anteil des Sonnenlichtes ähnlich wie beim Bärenklau eine Photodermatitis, sprich einen Sonnenbrand auslösen. Bei Trockenfeigen ist die Gefahr wesentlich geringer. Die im Internet kursierende Behauptung, dass man Feigen grundsätzlich nur gekocht essen soll ist allerdings, wenn man kein Allergiker ist, barer Unsinn.
Die Feigenfrüchte oder der Feigenbaum? Erstere werden je nach Sorte bis zu zehn Zentimeter groß; sie sind im reifen Zustand gelb, braun oder violett. Feigenbäume werden bei uns drei bis vier Meter, in ihrer mediterranen Heimat bis zu zehn Meter hoch und zeichnen sich durch ihre weit ausladende Krone und die markanten Feigenblätter aus.
Bis um die -10 °C übersteht ein Feigenbaum im Freiland. Allerdings sollte er dabei einigermaßen geschützt vor kalten und austrocknenden Winden stehen, und der Frost sollte nicht tagelang anhalten. Dann wäre gegebenenfalls etwas Kälteschutz angesagt. Daher findet man die Feige im Freiland in Deutschland ausschließlich in den wärmeren Gebieten. Feigenbaum im Kübel sollte man auf jeden Fall schon deutlich früher ins Haus holen und überwintern, am besten sobald sich die ersten Fröste drohen. Lieber zu früh als zu spät.
Ja, wenn man in einer der wärmeren Gegenden Deutschlands wohnt. Der Feigenbaum stammt aus deutlich wärmeren Gefilden wie der Mittelmeerregion und den vorderasiatischen Ländern bis nach Indien hinein. Da bekommen die Pflanzen im Winter deutlich höhere Temperaturen ab. Wo Wein gut wächst kann sich meistens auch die Echte Feige halten. Allerdings musst Du darauf achten, dass sie windgeschützt steht und reichlich Sonne und Wärme bekommt. Das beste Erfolgsrezept für eine gut wachsende Feige sind warme Sommer und milde Winter.
Hast Du einen kleinen Feigenbaum als Kübelpflanze auf dem Balkon oder auf der Terrasse stehen solltest Du ihn im Herbst ins Haus holen, sobald die ersten Fröste drohen. Nicht wundern, wenn er schon vorher die Blätter verliert, das ist bei der Echten Feigen vollkommen normal. Prinzipiell kann die Pflanze auch über -10 °C überstehen, aber das Risiko möchtest Du sicher lieber nicht eingehen.
Das ist ganz normal, zumindest im Herbst. Der Feigenbaum ist sommergrün, im Gegensatz zu den nahen verwandten Zimmerpflanzen wie Birkenfeige oder Geigenfeige. Wenn er allerdings bereits im Sommer seine Blätter verliert, so liegt das meistens an zu viel Wasser. Er hat es zwar gerne gleichmäßig leicht feucht, aber Staunässe mag er überhaupt nicht. Überdüngen solltest Du ihn auch nicht, auch wenn er im Wachstum für ein paar regelmäßige Gaben eines stickstoffhaltigen Düngers dankbar ist – auch hier gilt: nicht übertreiben!
Vor allem vorsichtig ;-). Die Echte Feige liebt einen gleichmäßig feuchten Boden, der zudem grundsätzlich gut durchlässig sein sollte. Im Freiland oder bei Kübelpflanzen kannst Du die Erde, wenn sie zu fest und schwer ist, mit einer Handvoll Rindenstückchen auflockern. Im Sommer lässt Du ihn am besten nicht allzu trocken werden, aber auch zu viel gießen wäre unproduktiv, denn Staunässe erweist sich schnell als tödlich. Das beste Indiz für Ich habe Durst: Der Feigenbaum lässt die Blätter hängen, im Extremfall fallen sie ebenso wie die Früchte ab. Letztere sogar als Erstes. Im Winterstand solltest Du bei einer in Kübel oder Container gehaltenen Feige nur sehr sparsam gießen.
Wahrscheinlich weil es ihnen zu kalt ist. Der Feigenbaum braucht reichlich Sonne und Wärme, und in unseren Breiten reicht das für den Exoten vom Mittelmeer oft nicht. Egal ob im Freiland oder als Kübelpflanze, sagt ihm das Klima oder das Wetter nicht zu wird das nichts mit der Ernte, und die halbreifen Früchte fallen ab oder vertrocknen am Baum.
Echte Feige ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.