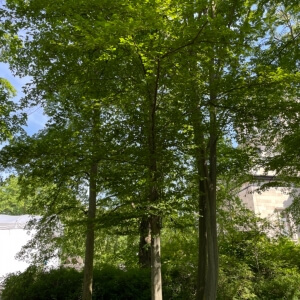Was ist Schnee-Heide?
Die Schnee-Heide gehört zu den Heidekrautgewächsen (Ericaceae) und ist mit dem bekannten Heidekraut (Calluna vulgaris) nahe verwandt. Als niederliegender Zwergstrauch erreicht sie eine Höhe von nur etwa 30 Zentimetern; ihren Namen hat sie ihren Vorkommen in den europäischen Gebirgen wie Alpen und Pyrenäen zu verdanken, wo sie in Höhenlagen bis über 2.500 Meter vorkommt.
Von Heidekraut lässt sie sich leicht durch ihre zu viert in Quirlen stehenden nadelförmigen Blätter unterscheiden, von der ebenfalls sehr ähnlichen Grau-Heide (Erica cinerea) durch die frühe Blütezeit von Februar bis Mai – die graue Verwandtschaft blüht erst im Juni und Juli. Tatsächlich sieht man die Schnee-Heide bereits im Schnee blühen, wo sie mit ihren aparten Blüten besonders auffällt. Dadurch erklären sich auch andere Trivialnamen wie Winter-Heide und Frühlings-Heide.
Die bei der Wildform rosafarbenen, in dichten Trauben an den Enden der Stängel stehenden Blüten sind wie bei Heidekrautgewächsen üblich glockenförmig und bestechen im Garten durch ihre dekorative Blütenfülle. Auffällig sind die aus den Kronen herausragenden Staubblätter, die nur wenig vom rosafarbenen Griffel überragt werden. Die nur zwei Millimeter großen Kapselfrüchte bleiben in der vertrocknenden Krone und fallen mit ihr zusammen ab.
Schnee-Heide im Garten
Standort
Die meisten Heidekrautgewächse bevorzugen einen eher sauren Boden und mögen Kalk nicht wirklich; da macht die Schnee-Heide eine seltene Ausnahme, denn sie wächst in den Alpen bevorzugt auf dem Calcium-reichen Dolomit. Kalkhaltige Böden sind für sie weniger ein Problem. Zudem sollte der Boden nährstoffarm und gut durchlässig sein.
Achtung – das ist wichtig: Die Schnee-Heide lebt symbiotisch mit einem Mykorrhiza-Pilz zusammen, den sie in Deinem Garten nicht unbedingt wiederfindet. Daher ist es wichtig, dass Du den kompletten Wurzelballen einpflanzt – dann sollte der Pilz mit von der Partie sein.
Schnitt
Viel zu schneiden gibt es bei dieser eher zierlichen und immergrünen Heide nicht; es reicht vollkommen aus, wenn Du ab und zu mal die abgestorbenen Zweigchen abschneidest. Ansonsten ist sie gut schnittverträglich und lässt sich problemlos in Form bringen, wenn Du sie stutzen möchtest.
Vermehrung
Zum Vermehren kannst Du Dich an den Samen in den Kapseln versuchen. Allerdings ist das eine lange Geschichte, und mit einer „fertigen“ Schnee-Heide aus dem Gartenhandel kommst Du definitiv schneller voran. Zudem musst Du den obigen Hinweis beachten: Ohne ihren Mykorrhiza-Pilz wird eine aus Sämlingen gezogene Erica carnea recht kümmerlich wachsen.
Verwendung
Am schönsten kommt die Schnee-Heide zur Geltung, wenn Du sie in größeren Gruppen pflanzt. Sie macht sich an halbschattigen bis sonnigen Standorten gut als Bodendecker. Besonders hübsch sieht das aus, wenn Du verschiedenfarbige Sorten nebeneinander pflanzt. Aber auch so ist die Winter-Heide eine ungewöhnliche Pflanze – wo sieht man schon mal die typischen Erika-Glöckchen aus der Schneedecke hervorlugen…
Falls Du Dich wunderst, wie die Winter-Heide mitten im Schnee blühen kann: Da haben die Pflanzen bereits im Herbst vorgesorgt und die Knospen vorab gebildet, die sich dann nur noch bei den ersten warmen Tagen zu entfalten brauchen
Schädlinge
Schädlinge und Krankheiten wirst Du bei der äußerst widerstandsfähigen Schnee Heide so gut wie nie antreffen. Der Standort im Gebirge hat die Erikagewächse ziemlich hart im Nehmen gemacht, und Schnecken und sonstige Interessenten suchen sich lieber einen anderen Snack.
Ökologie
Die Schnee-Heide wächst wild vor allem in den Alpen, wo sie zusammen mit Kiefern und Lärchen Zwergstrauchheiden nahe der Waldgrenze bildet. Dort ist sie eine wichtige frühblühende Futterquelle für Insekten, deren Tisch in diesen Hochregionen nur spärlich gedeckt ist. Dazu gehören vor allem Tagfalter, Honigbienen und einige Wildbienen. Allerdings kommen Besucher mit kurzem Rüssel kaum an den wohlgeschützten Nektar; Erdhummeln und Honigbienen beißen daher kurzerhand die Blüten seitlich auf, um an die Nahrung zu gelangen – nicht unbedingt immer mit Erfolg bei der Bestäubung. Weniger Probleme haben einige Wildbienen. Dazu zählt auch die Felsheiden-Mauerbiene Osmia inermis, übrigens die einzige Osmia-Art, die ähnlich wie Hummeln kleine Kollektive bildet und in ihren Nestern bis zu 200 Brutzellen betreuen.
Gewitterwürmchen als Bestäuber. Wichtiger als die „üblichen Verdächtigen“ sind bei Erica carnea kuriose Pollentaxis, deren Verwandtschaft man eher ungerne an seinen Pflanzen sieht: Blasenfüße. Keine Sorge, diese speziellen Thripse (Taeniothrips ericae) werden Deinen Garten nicht mit Unheil überziehen. In den Alpen nennt man sie auch Gewitterwürmchen, da sie bei aufziehendem Gewitter mit den Aufwinden in der Luft umhertreiben; die ansonsten wegen ihrer winzigen fransigen Flügel schlechten Flieger sind in praktisch allen Blüten zu finden. Dort leben sie vom Nektar, und nur die geflügelten Weibchen verlassen die Blüte, um in anderen Glöckchen mit fremden Männchen Hochzeit zu feiern und die Generationenfolge zu sichern. Diese Untermieter sorgen für Selbstbestäubung und Fremdbestäubung der Schnee-Heide und einiger verwandter Arten.
Unbedingt wichtig ist das Grün der Winter-Erika im Gebirge für die Raupen von Heidekrauteulchen (Anarta myrtilli) und Heidekraut-Blütenspanner (Eupitecia nanata), zweier als Erwachsene recht unauffälligen Nachtfaltern. Die gelb getupften grünen Raupen der Letzteren sind mit ihrer Farbe bestens an die angefressenen Erika-Stängel angepasst und kaum zu erkennen.